In den ersten Stunden nach der Geburt wird ein Kind zum ersten Mal untersucht – die so genannte U1 steht an. Diese Untersuchung wird noch am Geburtsort, im Kreißsaal, Geburtshaus oder zuhause, von der Hebamme durchgeführt. Dabei schaut sie sich das Baby von Kopf bis Fuß an. Sie prüft seine Reflexe, hört Herz und Lunge ab, wiegt und misst es.
Diese erste Vorsorgeuntersuchung soll klären, ob das Neugeborene die Geburt gut überstanden hat oder ob es Einschränkungen oder Fehlbildungen hat, die sofort einer Behandlung bedürfen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in das „Gelbe Heft“ eingetragen, das Kinderuntersuchungsheft. Dieses Heft begleitet das Kind von der U1 bis zur U9 in den ersten sechs Jahren seines Lebens.
Info: Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA), ein Zusammenschluss der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, gibt seit 1971 eine Kinderrichtlinie in regelmäßig aktualisierter Form heraus. Diese regelt die Vorsorgeuntersuchungen und dienst als Basis für das Kinderuntersuchungsheft.
Bei den Vorsorgeuntersuchungen, die im ersten Lebensjahr in engeren Abständen, später seltener stattfinden, geht es darum, das Kind in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung zu beobachten. Jeder Mensch entwickelt sich individuell, hat von Beginn an Stärken und Schwächen. Fachpersonen wie Kinderärzt*innen und Entwicklungspsycholog*innen können feststellen, wenn es Entwicklungsverzögerungen gibt. Sie erkennen auch Erkrankungen, die behandelt werden sollten.
Zwischen Normalität und Auffälligkeit
Gerade beim ersten Kind kann es Eltern schwerfallen, die Grenze zwischen Normalität und Auffälligkeit zu ziehen. Bis wohin ist es normal, dass ein Baby eine motorische Entwicklung noch nicht vollzogen hat? Und ab wann sollte es Unterstützung bekommen?
Hier kann das Gespräch mit der Kinderärztin oder dem Kinderärzt eine Hilfe sein. Im besten Fall kennen sie das Kind seit seiner Geburt und schätzen es mit ihrem professionellen Blick richtig ein.
Die ersten drei Vorsorgeuntersuchungen (U1-U3) finden in den ersten fünf Lebenswochen statt. Neben der Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme kann es den Eltern helfen, regelmäßig eine kinderärztliche Bestätigung zu bekommen, dass sich ihr Baby normal entwickelt. Gerade in den ersten Wochen und beim ersten Kind gibt es einen großen Bedarf an Beratung zu Themen wie Stillen und Ernährung, Prophylaxen und plötzlicher Kindstod. Es empfiehlt sich, noch in der Schwangerschaft eine Kinderarztpraxis in Wohnortnähe auszusuchen.
Gelbes Heft genau anschauen
Die Kinderärztin oder der Kinderarzt können die Eltern unterstützen, in dem sie zum Beispiel bei mangelnder Gewichtszunahme eine Milchpumpe verschreiben, eine Neugeborenen-Gelbsucht behandeln oder bei Haltungsanomalien zu einer physiotherapeutischen Praxis überweisen.
Die Vorsorgeuntersuchungen werden meist weit im Voraus vereinbart. Die meisten Praxen bieten spezielle Zeiträume dafür an, damit gesunde Kinder im Wartezimmer nicht in Kontakt mit kranken Kindern aus der Akut-Sprechstunde kommen.
In Vorbereitung auf den Vorsorgetermin kann es hilfreich sein, sich das Gelbe Heft genauer anzuschauen. Zu jeder Vorsorgeuntersuchung gibt es dort einen erklärenden Text für die Eltern, in welcher Entwicklungsphase sich ihr Kind gerade befindet und was Bestandteil der anstehenden Vorsorgeuntersuchung sein wird. Dazu findet sich in dem Heft jeweils Platz, um Fragen oder Beobachtungen zu notieren. Die Vorsorguntersuchungen können für Eltern und Kind eine angespannte Situation darstellen. Ein „Spickzettel“ mit notierten Fragen ist da hilfreich.
Zeit für Beratung
Ebenfalls wird in dem Heft der Ablauf der Untersuchung dargestellt: nach einer orientierenden Beurteilung der Entwicklung kreuzt die Kinderärztin stichpunktartig alle körperlichen Aspekte des Kindes an. Die Feststellung von Körpergewicht und -länge gehört auch zur Untersuchung.
Nicht selten fällt den Eltern gar nicht auf, wie jedes Detail ärztlich überprüft wird, weil sie mit ihrer Erfahrung das Kind schon in kurzer Zeit einschätzen können. Am Ende der Untersuchung sollte Zeit für Beratung sein – zum Beispiel zu anstehenden Impfungen, Zahnhygiene, Unfallverhütung oder regionalen Unterstützungsangeboten.
Die U-Untersuchungen werden auch Früherkennungsuntersuchungen genannt. Es geht darum, möglichst früh festzustellen, wann ein Kind Unterstützung braucht – zum Beispiel bei der sprachlichen Entwicklung. Von der Fähigkeit, sich ausdrücken zu können, hängt so vieles ab, dass es Sinn ergibt, eine etwaige Einschränkung früh festzustellen. So ist zum Beispiel der Hörtest bei der U2 ein wichtiger Mosaikstein für die Sprachentwicklung. Ein Baby, das nicht oder nur teilweise hören kann, wird auch erschwert sprechen lernen.
Frühförderung wenn nötig
Das frühe Erkennen einer Einschränkung oder einer Erkrankung ermöglicht die frühe Förderung des Kindes – sei es durch Physiotherapie, Ergotherapie oder andere Maßnahmen. Mit Frühförderung ist kein Wettbewerb gemeint. Es geht nicht darum, dass ein Kind möglichst früh krabbelt oder läuft, spricht oder malt. Manchen Eltern fällt es schwer, die Fragen der Kinderärztin nicht in diese Richtung zu verstehen.
Bei späteren Vorsorgeuntersuchungen, wenn das Kind bereits spricht, kann der Termin auch für alle Beteiligten zur Herausforderung werden, weil es ganz normal ist, dass auch kleine Menschen nicht auf Knopfdruck Leistungen erbringen. Und nicht immer bereit sind, mit einem für sie nahezu fremden Menschen in Kontakt zu gehen.
Die Vorsorge für Kinder in den ersten sechs Lebensjahren wird von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen bezahlt. Für die zehn Vorsorgeuntersuchungen (U1-6, U7+7a, U8-9) gibt es klar definierte Zeiträume, in denen sie stattfinden sollen. Findet ein Termin deutlich später statt, kann es sein, dass die Kosten nicht mehr von der Krankenkasse übernommen werden.
Vorsorge hat immer zwei Seiten
Die Vorsorge hat hier zwei Seiten: Einerseits ist es Privatsache der Eltern, ob und wann sie ihr Kind einer Kinderärztin vorstellen. So wird auch im Gelben Heft explizit darauf hingewiesen, dass keine Institution, wie zum Beispiel der Kindergarten, die Schule oder das Jugendamt, Einsicht in die Dokumentation verlangen darf.
Andererseits haben Krankenkassen ein Interesse daran, dass Kinder an Vorsorgen teilnehmen. Und Kindergärten können zum Beispiel den Nachweis verlangen, dass ein Kind die empfohlenen Impfungen erhalten hat.

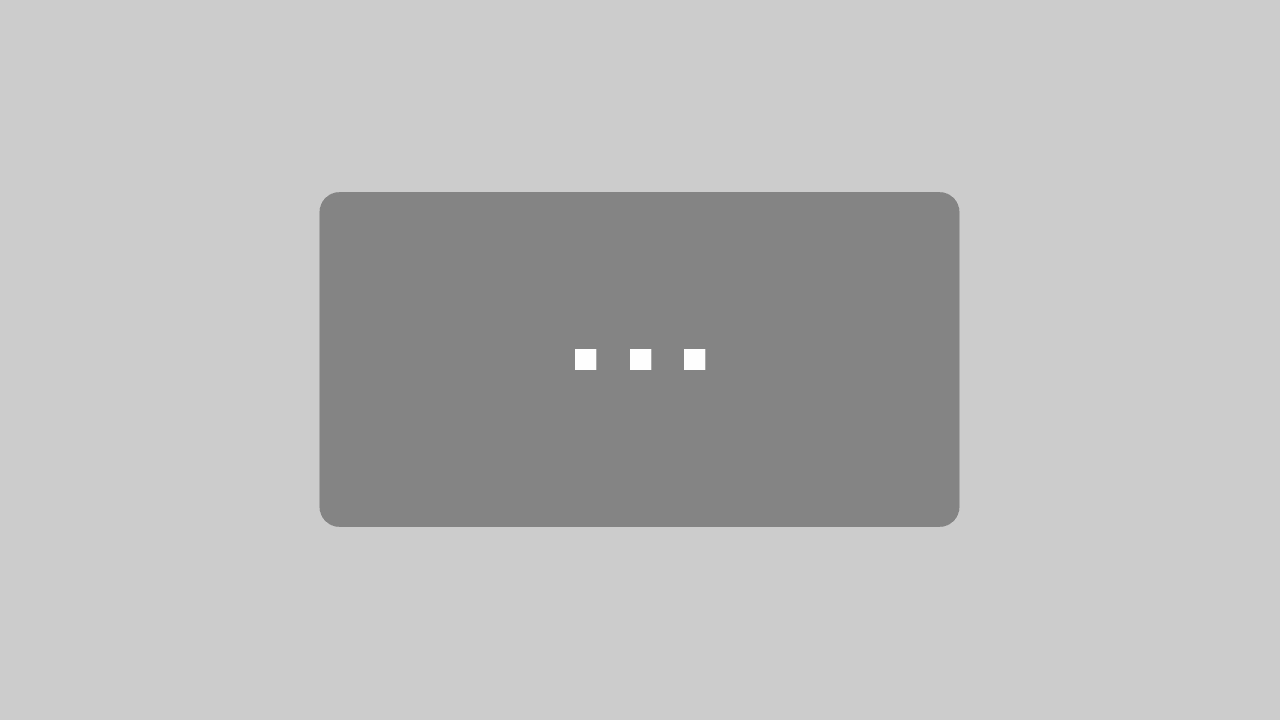



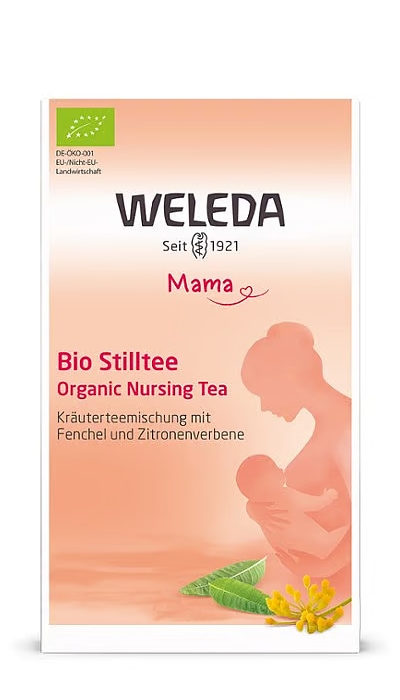






Schreibe einen Kommentar